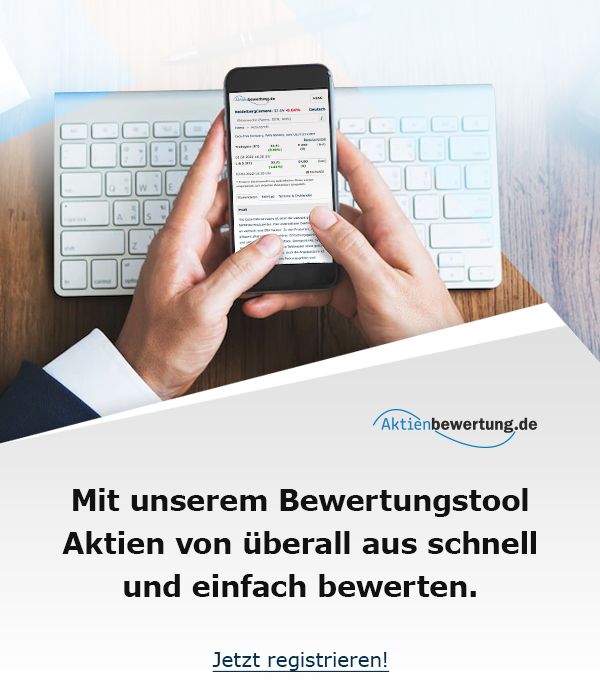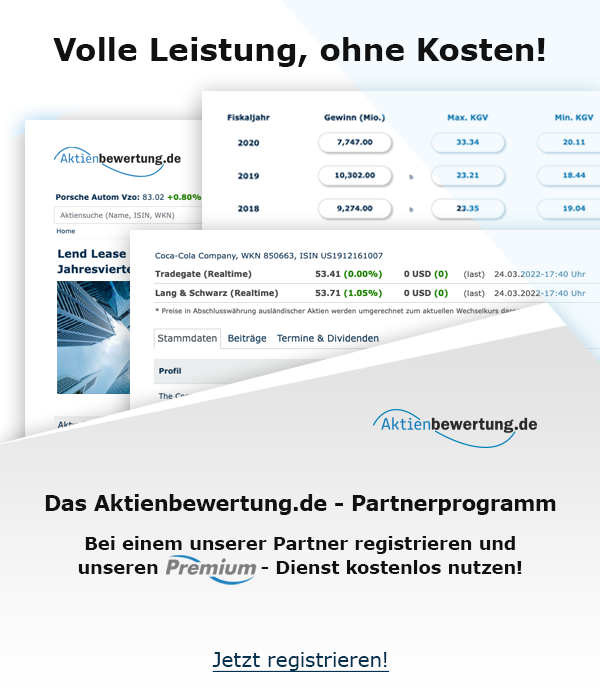Die Integration erneuerbarer Energien in Europa schreitet voran, dennoch bleibt die Versorgungssicherheit in kritischen Phasen – etwa im Winter, in der Nacht oder während längerer Dunkelflauten – herausfordernd. Deutschland produziert zwar bereits einen hohen Anteil seines Stroms aus Wind- und Solarenergie, ist in solchen Situationen jedoch weiterhin auf fossile Reservekraftwerke, Speicherlösungen und Importe angewiesen. Vom Ausbau der Energie-Infrastruktur profitieren insbesondere europäische Versorger.
Die Integration erneuerbarer Energien in Europa schreitet voran, dennoch bleibt die Versorgungssicherheit in kritischen Phasen – etwa im Winter, in der Nacht oder während längerer Dunkelflauten – herausfordernd. Deutschland produziert zwar bereits einen hohen Anteil seines Stroms aus Wind- und Solarenergie, ist in solchen Situationen jedoch weiterhin auf fossile Reservekraftwerke, Speicherlösungen und Importe angewiesen. Vom Ausbau der Energie-Infrastruktur profitieren insbesondere europäische Versorger.
Frankfurt/Main, den 26.08.2025: Die Energiewende in Deutschland hat vieles verändert, der Umbruch ist nur teilweise gelungen. Ein schwerwiegender Nachteil ist die neue Abhängigkeit Deutschlands von Stromimporten. Sie erhöhen den Handlungsdruck, die Infrastruktur auszubauen: Leistungsfähige Stromtrassen, neue Speichertechnologien und grenzüberschreitende Netzanbindungen werden zum Schlüssel für die Transformation.
Der Netzausbau ist dabei eine der zentralen Baustellen. Unternehmen wie TenneT, als größter Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland und den Niederlanden, spielen eine entscheidende Rolle beim Bau von Nord-Süd-Trassen wie SuedLink. Diese Leitungen sollen den Strom aus windreichen Küstenregionen in die industriellen Zentren transportieren. Doch Netze allein reichen nicht aus. Siemens Energy arbeitet deshalb an der Modernisierung der Netztechnik, etwa mit Investitionen in Schaltanlagen und digitale Steuerungssysteme, die eine effizientere Auslastung bestehender Leitungen ermöglichen. Solche Technologien sind essenziell, da die Strommengen künftig deutlich steigen werden – nicht zuletzt durch Elektromobilität und Rechenzentren.
Versorger im Fokus
Parallel dazu treiben Energieversorger wie RWE und EnBW die Erzeugung und Speicherung voran. RWE investiert in große Offshore-Windparks in der Nordsee und koppelt diese mit Wasserstoffprojekten, um überschüssigen Strom langfristig nutzbar zu machen. EnBW wiederum entwickelt eigene Wasserstoffstandorte und beteiligt sich an Pilotprojekten, die Erzeugung, Speicherung und Transport verknüpfen. Beide Konzerne sind damit nicht nur Erzeuger, sondern auch Infrastrukturakteure, die aktiv am Aufbau eines künftigen Wasserstoff-Kernnetzes mitwirken. Solche Projekte zeigen, wie eng der Ausbau von Netzen, Speicherlösungen und Erzeugungstechnologien miteinander verwoben sind.
Eine wichtige Rolle übernehmen zudem spezialisierte Technologieanbieter. ThyssenKrupp Nucera hat sich als Produzent von Elektrolyseuren etabliert, die Strom in Wasserstoff umwandeln. Die Systeme sind kompakter und effizienter geworden und ermöglichen es Industrieunternehmen, insbesondere in der Stahlproduktion, ihre Prozesse schrittweise zu dekarbonisieren. Während Unternehmen wie RWE und EnBW die Projekte entwickeln, liefert Nucera die dafür benötigte Technik. Ergänzend tritt ABO Energy als Projektentwickler auf, der Wind- und Solarparks plant und zunehmend auch Batteriespeicher und Wasserstoffprojekte integriert. Damit wird ein weiteres Bindeglied geschaffen, das lokale Erzeugung, Netzeinspeisung und Speicher koppelt.
Speicherinfrastruktur notwendig
Trotz dieser Fortschritte bleibt die Speicherfrage ungelöst. Batteriesysteme können kurzfristige Lastspitzen ausgleichen, doch für längere Dunkelflauten sind sie noch unzureichend dimensioniert. Wasserstoff gilt als vielversprechender Energiespeicher, benötigt jedoch den Aufbau einer eigenen Transport- und Speicherinfrastruktur. Deutschland plant hierfür ein Kernnetz, dessen Umsetzung hohe Investitionen erfordert. Bis diese Strukturen in vollem Umfang verfügbar sind, wird die Abhängigkeit von Stromimporten bestehen bleiben.
Insgesamt zeigt sich ein enges Zusammenspiel zwischen Netzbetreibern, Technologieanbietern, Versorgern und Projektentwicklern. Während TenneT die Stromautobahnen errichtet, Siemens Energy die Steuerungstechnik bereitstellt und RWE sowie EnBW großskalige Projekte mit Wind und Wasserstoff vorantreiben, liefern Nucera und ABO Energy die Planung und die technologische Basis für die nächste Ausbaustufe.
Für Anleger ergeben sich vielfältige Investitionsmöglichkeiten. Die Energiebranche ist, wie die Beispiele zeigen, stark fragmentiert, wobei das größte Potenzial bei europäischen Versorgern zu finden ist. Sie profitieren von der laufenden Investitionsoffensive in den Netzausbau. Die Aktien vieler dieser Unternehmen notieren auf dem niedrigsten Bewertungsniveau seit 15 Jahren, und das trotz deutlich gestiegener Ertragskraft. Ursächlich für die Diskrepanz zwischen Bewertung und Wachstumsaussichten sind vor allem die hohen Investitionen, die kurzfristig Margen und Ergebnisse belasten, hinzu kommen schwankende Energiepreise und steigende Finanzierungskosten.
Langfristig sollten die beschriebenen Unternehmen von den steigenden Anforderungen an die Versorgungssicherheit und die zunehmende Nutzung von Biogas und Wasserstoff jedoch deutlich profitieren, da diese zu massiven Investitionsprogrammen ins Strom- und Gasnetz führen. Für Versorger bedeutet das: stabile, inflationsgeschützte Renditen auf eine wachsende Anlage-Basis.
Investmentidee(n) auf den Stoxx Europe 600 Utilities-Index
Neben Einzelinvestments in die beschriebenen Titel oder Energieunternehmen können Anleger mit einem Investment auf die gesamte europäische Versorgerbranche setzen: dem Indexzertifikat auf den Stoxx Europe 600 Utilities mit der ISIN: CH0013716011. Anleger partizipieren 1:1 an der Wertentwicklung des Stoxx Europe 600 Utilities-Index, bei steigenden und fallenden Kursen. Eine Managementgebühr wird nicht erhoben, der Spread liegt bei rund 0,40 %.